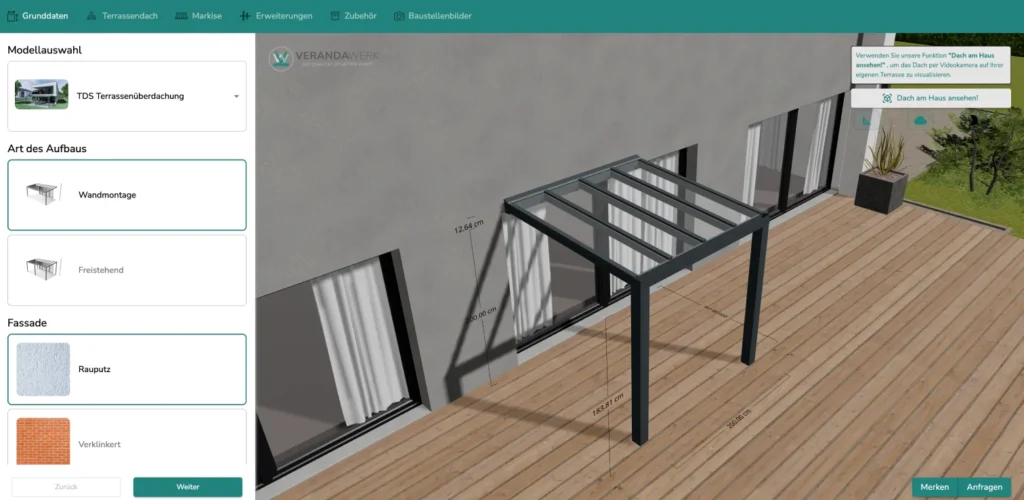Die 5 wichtigsten Punkte auf einen Blick
- Welches Fundament für den Wintergarten? Die Wahl hängt von Bodenbeschaffenheit, Budget und Nutzungsart (Warm- oder Kaltwintergarten) ab.
- Betonbodenplatte für den Wintergarten: Stabil und langlebig, vor allem bei schwerem Aufbau zu empfehlen.
- Isolierte Bodenplatte: Ideal für Warmwintergärten, da sie Wärmeverluste reduziert.
- Punkt-, Streifen- und Ringfundament: Klassische Lösungen, vorteilhaft bei kleinerer Baufläche; jedoch meist weniger dämmend als eine Platte.
- Schraubfundament: Schnelle und einfache Montage, in vielen Fällen eine kostengünstige Alternative.
Die Qual der Wahl - Welches Fundament für den Wintergarten?
Die Entscheidung, welches Fundament zu Ihrem Wintergarten passt, hängt nicht nur von Ihrem Budget ab, sondern auch von der Beschaffenheit des Untergrunds, den lokalen Wetter- und Klimabedingungen sowie der geplanten Nutzung. Ein Warmwintergarten, der ganzjährig genutzt wird, stellt andere Anforderungen an das Fundament als ein Kaltwintergarten, der nur als geschützter Übergangsbereich dient. Aber der Reihe nach…
Betonbodenplatte für den Wintergarten
Die Betonbodenplatte gehört zweifelsohne zu den Klassikern unter den Fundamentarten. Sie besteht aus einer vollflächig gegossenen Schicht Beton, die eine ebene und sehr tragfähige Basis für den Wintergarten bildet.
|
Vorteile
|
Nachteile
|
|---|---|
|
Hohe Stabilität: Eine Betonbodenplatte verteilt das Gewicht des Wintergartens gleichmäßig und sorgt für eine feste Verankerung im Boden.
|
Höherer Aufwand: Das Gießen einer Bodenplatte erfordert meist mehr Erd- und Schalungsarbeiten sowie eine genaue Nivellierung.
|
|
Dauerhaftigkeit: Bei sachgemäßer Ausführung ist dieses Fundament sehr langlebig und wartungsarm.
|
Keine punktuelle Anpassung möglich: Die Betonplatte ist eine großflächige Lösung und kann nur schwer teilweise verändert werden, falls der Untergrund unterschiedlich beschaffen ist.
|
|
Hohe Traglast: Auch bei schwereren Konstruktionen, zum Beispiel aus Stahl oder Aluminium mit großen Glasflächen, bietet eine Bodenplatte die notwendige Stabilität.
|
Längere Bauzeit: Nach dem Gießen muss die Platte ausreichend trocknen, bevor mit der weiteren Konstruktion begonnen werden kann.
|
Wie tief sollte eine Betonbodenplatte sein?
Die Dicke einer Betonbodenplatte für einen Wintergarten liegt in der Regel bei 10 bis 15 Zentimetern. Dazu kommen unter Umständen eine Kies- oder Schotterschicht sowie eine Frostschutzschicht, die zusammen ebenfalls zwischen 10 und 20 Zentimetern betragen können. Die Gründungstiefe richtet sich nach den lokalen Frosttiefen; in Deutschland liegt diese üblicherweise zwischen 80 und 100 Zentimetern. Sofern eine Randverstärkung (Fundamentstreifen) vorgesehen ist, kann dort die Tiefe weiter in den frostfreien Bereich reichen.
Isolierte Bodenplatte
Eine isolierte (gedämmte) Bodenplatte ist prinzipiell eine Betonbodenplatte, allerdings mit integrierten Dämmmaterialien, um Wärmeverluste zu reduzieren.
|
Vorteile
|
Nachteile
|
|---|---|
|
Hohe Energieeffizienz: Durch die Dämmung wird die Bodenplatte zum Wärmepuffer, was sich besonders für Warmwintergärten eignet.
|
Mehrkosten: Dämmmaterialien und ein fachgerechter Einbau erhöhen die Baukosten.
|
|
Verbesserter Wohnkomfort: Ein angenehmes Raumklima wird gefördert, da Boden und Innentemperatur ausgeglichener sind.
|
Planungsaufwand: Man muss genau berechnen, wo und wie die Dämmung eingebaut wird, damit keine Wärmebrücken entstehen.
|
|
Werterhalt: Eine gut gedämmte Konstruktion wirkt sich positiv auf den Gesamtwert der Immobilie aus und kann langfristig Energiekosten senken.
|
Komplexere Ausführung: Bei fehlerhafter Verlegung der Dämmung kann Feuchtigkeit eindringen und diese beschädigen.
|
Wie tief sollte eine isolierte Bodenplatte sein?
Auch hier ist eine Gesamtdicke von etwa 10 bis 15 Zentimetern Beton üblich, ergänzt durch eine Dämmschicht von mindestens 5 Zentimetern – je nach gewünschter Wärmedämmung kann es auch mehr sein. Die Gründung selbst sollte ebenfalls frostsicher erfolgen, also mindestens 80 bis 100 Zentimeter in den Boden reichen. Unterhalb der Betonplatte kann zusätzlich eine Kiesschicht als kapillarbrechende Schicht (gegen aufsteigende Feuchtigkeit) dienen.
Punktfundament für den Wintergarten
Ein Punktfundament besteht aus mehreren vertikalen Betonblöcken, die gezielt unter den Stützpfosten oder Eckpfeilern des Wintergartens angeordnet werden. Diese tragen das Gewicht der Konstruktion punktuell.
|
Vorteile
|
Nachteile
|
|---|---|
|
Geringerer Materialeinsatz: Da nur kleine Bereiche ausgehoben und mit Beton gefüllt werden, verbraucht man weniger Beton.
|
Punktuelle Lastverteilung: Bei schweren Konstruktionen oder ungleichmäßigem Untergrund kann es zu Setzungen kommen.
|
|
Flexibel und kostengünstig: Für kleinere bis mittlere Bauten häufig eine gute und günstige Alternative, wenn keine hohen Lasten zu erwarten sind.
|
Kein durchgehender Boden: Wenn Sie eine dichte und flächige Lösung wünschen, z. B. aus ästhetischen oder praktischen Gründen, ist das Punktfundament ungeeignet.
|
|
Weniger Erdarbeiten: Es muss nur an den vorgesehenen Punkten gegraben werden.
|
Aufwendige Planung: Die Positionen der Punktfundamente müssen genau bekannt sein, um die Traglast zu verteilen.
|
Wie tief sollte ein Punktfundament sein?
Punktfundamente müssen bis in den frostfreien Bereich reichen, also in Deutschland mindestens 80 Zentimeter, in kälteren Regionen auch mehr. Oft wird eine Tiefe von 80 bis 100 Zentimetern empfohlen. Der Durchmesser jedes Punktfundaments variiert je nach Last und Bodenbeschaffenheit; üblich sind 30 bis 50 Zentimeter.
Träumen Sie von einem Wintergarten?
Verandawerk macht Ihren Traum wahr! Kontaktieren Sie uns jetzt für Ihre individuelle Beratung und erfahren Sie alles über Genehmigungen und Planung. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Wohlfühlraum erschaffen – ganzjährig und wetterunabhängig.
Streifenfundament für den Wintergarten
Das Streifenfundament ist im Grunde ein umlaufender oder segmentierter Betongraben, der meist unter den tragenden Außenwänden beziehungsweise Stützen verläuft. Diese Variante findet oft im Hausbau Anwendung, eignet sich jedoch auch für Wintergärten.
|
Vorteile
|
Nachteile
|
|---|---|
|
Solide Lastverteilung: Das Gewicht wird über die gesamte Länge der Außenkanten verteilt.
|
Kein flächiger Bodenabschluss: Zwischen den Streifen bleibt der Untergrund unverändert. Für einen dichten Bodenabschluss wird dennoch eine zusätzliche Schicht (z. B. Estrich) benötigt.
|
|
Planungssicherheit: Diese Bauweise ist langjährig erprobt und sehr stabil.
|
Aufwendige Schalungsarbeiten: Die Gräben müssen exakt gegraben und eingeschalt werden.
|
|
Weniger Beton als bei einer ganzen Platte: Wer keine durchgängige Bodenplatte benötigt, kann mit einem Streifenfundament Kosten sparen.
|
Wärmebrücke möglich: Wenn Sie den Wintergarten beheizen möchten, kann ein Streifenfundament zur Kältebrücke werden, sofern keine adequate Dämmung vorhanden ist.
|
Wie tief sollte ein Streifenfundament sein?
Genau wie bei anderen Fundamenten muss der frostfreie Bereich erreicht werden. Die Standardtiefe liegt auch hier bei 80 bis 100 Zentimetern. Die Breite des Streifens richtet sich nach den statischen Erfordernissen – typischerweise 40 bis 50 Zentimeter.
Schraubfundament
Beim Schraubfundament, auch Erdschraube genannt, handelte es sich um eine vergleichsweise junge, aber dennoch sehr praktische Methode. Dabei werden Stahlankerelemente mit schraubenförmigem Profil in den Boden gedreht.
|
Vorteile
|
Nachteile
|
|---|---|
|
Schnelle Montage: Erdschrauben lassen sich in kurzer Zeit mithilfe spezieller Drehwerkzeuge setzen.
|
Begrenzte Tragkraft: Für sehr schwere oder große Wintergärten ist ein Schraubfundament oft nicht ausreichend.
|
|
Kein Aushub nötig: Es wird kaum Erdreich bewegt, weshalb weniger Baustellenschmutz anfällt.
|
Bodenabhängigkeit: In harten oder stark steinigen Böden ist das Eindrehen erschwert oder gar nicht möglich.
|
|
Reversibilität: Bei einer späteren Demontage kann das Fundament relativ leicht zurückgebaut werden.
|
Korrosionsschutz nötig: Die Schraubelemente sind Metall und müssen entsprechend vor Rost geschützt werden.
|
Wie tief sollte ein Schraubfundament sein?
Die Schraubfundamente sollten mindestens bis in den frostfreien Boden reichen, also auch hier 80 Zentimeter oder mehr. Oft werden längere Schrauben (z. B. 1 – 2 Meter) in den Boden gedreht, sodass eine ausreichende Stabilität und Sicherheit gegen Frosthebungen gewährleistet ist.
Ringfundament für den Wintergarten
Ein Ringfundament ist eine spezielle Form des Streifenfundaments, das den Baukörper ringförmig umschließt. Zusätzlich kann es diagonal oder kreuzförmig verstärkt sein, um die Lastverteilung zu optimieren.
|
Vorteile
|
Nachteile
|
|---|---|
|
Hohe Stabilität: Durch die umlaufende Form wird ein in sich geschlossener Tragwerksverbund geschaffen.
|
Mehr Material: Ein Ringfundament verwendet tendenziell mehr Beton und Bewehrung als einfache Streifenfundamente.
|
|
Geeignet für große Bauten: Bei größeren Wintergärten oder bei Kombinationen aus Mauerwerk und Glas bietet ein Ringfundament eine solide Basis.
|
Höhere Kosten: Die Stabilität hat ihren Preis – die Beton- und Bewehrungsmenge steigt.
|
|
Gute Verankerung: Eine geschlossene Form minimiert das Risiko von Setzrissen.
|
Aufwendige Erstellung: Eine rundum durchgehende Schalung und exakte Vermessung sind notwendig.
|
Wie tief sollte ein Ringfundament sein?
Auch hier gilt: frostfrei gründen. Der Fundamentring sollte mindestens 80 bis 100 Zentimeter tief ins Erdreich reichen, je nach regionalen Gegebenheiten und Bodenverhältnissen gegebenenfalls tiefer. Die Breite des Fundaments orientiert sich an der geplanten Wintergartenkonstruktion.
Fundament für Warmwintergarten vs. Fundament für Kaltwintergarten
Warmwintergarten
Ein Warmwintergarten dient als ganzjährig nutzbarer Wohnraum. Daher sollte logischerweise nicht nur die Verglasung und das Dach wärmegedämmt sein, sondern auch der Boden. Eine isolierte Bodenplatte oder ein Ringfundament mit integrierter Dämmung bietet sich hier an, um Wärmeverluste zu minimieren. Auch die Vermeidung von Kältebrücken sollte weit oben auf Ihrer Agenda stehen. Hier empfiehlt sich ein umlaufender Anschluss an das Mauerwerk des Hauses, der gut abgedichtet und gedämmt wird.
Kaltwintergarten
Ein Kaltwintergarten wird dagegen nur selten oder gar nicht beheizt. Die Anforderungen an den Wärmeschutz sind somit deutlich geringer. In vielen Fällen reicht hier ein Punkt-, Streifen- oder Ringfundament aus, sofern die Gesamtstatik stimmt. Eine aufwendige Dämmung ist bei einem Kaltwintergarten nicht zwingend erforderlich, sodass Sie Kosten sparen können. Wichtig! Dennoch sollten Sie auf eine frostfreie Gründung achten, um Schäden an der Konstruktion zu vermeiden.
Mit diesen Kosten können Sie rechnen
Klar: Die Kosten für ein Wintergarten-Fundament variieren je nach Fundamentart, Materialeinsatz und regionalen Preisgefügen. Bedenken Sie, dass zusätzlich Kosten für den Aushub, die Entsorgung des Erdaushubs, eventuelle Bodengutachten sowie eventuelle Dämm- und Abdichtungsarbeiten anfallen können. Wenn Sie mit einem Warmwintergarten planen, kommen gegebenenfalls Heizleitungen in der Bodenplatte oder weitere Dämmmaterialien hinzu.
Hier sind einige grobe Richtwerte zur besseren Orientierung:
- Betonbodenplatte: Zwischen 100 und 150 Euro pro Quadratmeter, abhängig von Dicke, Bewehrung und Vorbereitungsarbeiten. Eine isolierte Platte kann je nach Dämmschicht nochmals 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter mehr kosten.
- Punktfundament: Pro Punktfundament müssen Sie mit 50 bis 150 Euro rechnen (inklusive Material, Aushub und Beton). Die Anzahl der Fundamente richtet sich nach der Konstruktion.
- Streifenfundament: Da es sich über die Länge der Außenkanten erstreckt, wird meist in Kubikmetern Beton abgerechnet. Kosten liegen häufig bei 150 bis 250 Euro pro Laufmeter, je nach Breite, Tiefe und Stahlbewehrung.
- Schraubfundament: Pro Schraube können Kosten von 30 bis 100 Euro anfallen, zuzüglich Einbaukosten (Maschinen, Spezialwerkzeug). Für einen mittelgroßen Wintergarten benötigt man oft zwischen 6 und 12 Schrauben.
- Ringfundament: Ähnlich wie beim Streifenfundament, jedoch meist etwas aufwendiger – 200 bis 300 Euro pro Laufmeter sind keine Seltenheit.
So wird das Fundament für den Wintergarten angelegt
Die Anlage eines Wintergarten-Fundaments folgt in der Regel den gleichen Schritten wie bei anderen Bauprojekten, allerdings mit einigen „wintergarten-spezifischen” Besonderheiten:
Planung und Bodenuntersuchung
Vor Beginn aller Arbeiten empfiehlt sich ein Bodengutachten, zumindest aber eine fachkundige Einschätzung, um die Tragfähigkeit des Untergrunds festzustellen. Experten können feststellen, ob zusätzlicher Bodenaustausch oder spezielle Maßnahmen wie Drainage nötig sind.
Aushub und Vorbereitung
Je nach Fundamentart werden entweder Gruben (Punktfundamente), Gräben (Streifenfundamente) oder ein großer Bereich (Bodenplatte) ausgehoben. Dabei gilt: Besser etwas tiefer als zu flach, um den frostfreien Bereich zu erreichen. Ist der Boden sehr feucht, sollte eine Drainage oder eine kapillarbrechende Schicht aus Kies eingefügt werden.
Schalung und Bewehrung
Für Betonfundamente wird eine Schalung angebracht, damit der Beton in die gewünschte Form gebracht werden kann. Stahlmatten oder Bewehrungsstäbe stabilisieren das Fundament gegen Risse und garantieren eine gleichmäßige Kraftverteilung.
Betonieren
Wenn Sie sich für eine Bodenplatte oder Streifenfundamente entschieden haben, wird an einem Tag betoniert, damit der Beton homogen aushärten kann. Bei Punktfundamenten geschieht dies abschnittsweise pro Loch. Anschließend sollte der Beton einige Tage feucht gehalten werden, um ein zu schnelles Austrocknen und Rissbildung zu verhindern.
Dämmung und Abdichtung
Bei einem Warmwintergarten ist die Dämmung das Herzstück. Zwischen Betonplatte und Bodenbelag können Dämmplatten gelegt werden. Achten Sie darauf, dass sämtliche Fugen dicht abschließen. Zudem sollten Wandanschlüsse und Fundamentränder sorgfältig gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden.
Härtungs- und Trocknungsphase
Lassen Sie dem Fundament ausreichend Zeit, um auszuhärten. Eine schnelle Weiterverarbeitung kann zu Setzrissen führen, insbesondere wenn sich spätere Dachlasten oder Glasgewichte als schwer herausstellen.
Aufbau des Wintergartens
Ist das Fundament trocken und tragfähig, kann die eigentliche Montage des Wintergartens beginnen. Dabei sollte auf jeden Fall geprüft werden, ob das Fundament eben und frei von Rissen ist.
Profis erleichtern Ihnen die Arbeit
Auch wenn viele Heimwerker an einfachen Fundamentarbeiten selbst Hand anlegen, lohnt es sich in vielen Fällen, Fachleute hinzuzuziehen. Insbesondere bei einem Warmwintergarten, der hohe Anforderungen an Dämmung und Statik stellt, kann eine professionelle Beratung und Ausführung viele Probleme und Folgekosten verhindern. Darüber hinaus wird bei größeren Bauvorhaben oft eine Baugenehmigung nötig – hier sollten Sie sich an die zuständigen Behörden und ggf. Architekten oder Statiker wenden.
Wir halten fest
Ein Wintergarten ist mehr als nur ein „Glasanbau“ – er kann zu Ihrem ganz persönlichen Wohlfühlraum avancieren, in dem Sie die Natur zu jeder Jahreszeit genießen. Damit das gelingt, sollte das Fundament sorgfältig geplant und ausgeführt werden:
- Entscheiden Sie je nach Nutzungsart zwischen einer Betonbodenplatte (für große Stabilität) oder einer isolierten Platte (für bessere Energieeffizienz).
- Klassische Fundamente wie Punkt-, Streifen- und Ringfundamente eignen sich besonders für Kaltwintergärten oder weniger komplexe Bauten.
- Wer schnell und unkompliziert bauen möchte, kann auf Schraubfundamente setzen. Prüfen Sie jedoch die Tragfähigkeit Ihres Bodens und die Wintergartenlast.
- Bei Warmwintergärten spielt die Dämmung eine entscheidende Rolle, um Heizkosten zu minimieren und ein behagliches Klima zu schaffen.
- Frostfreie Gründung (80–100 cm) ist bei allen Fundamentvarianten Pflicht, um Schäden durch Frost und Setzungen zu vermeiden.
- Die Kosten variieren stark je nach Fundamentart und Bodenbeschaffenheit. Planen Sie für eine solide und fachgerechte Ausführung lieber etwas mehr Budget ein.
- Ziehen Sie bei Unsicherheiten Experten hinzu, um langfristige Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.